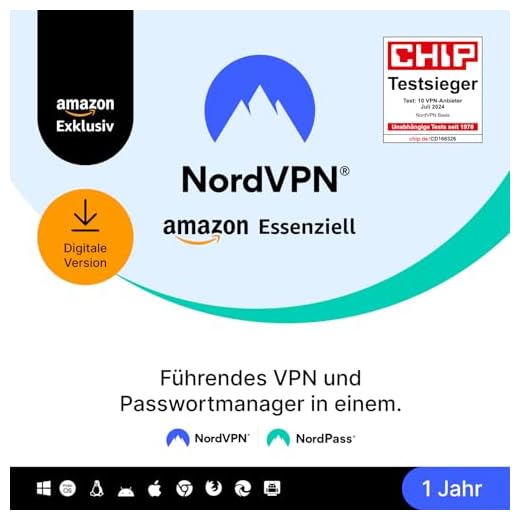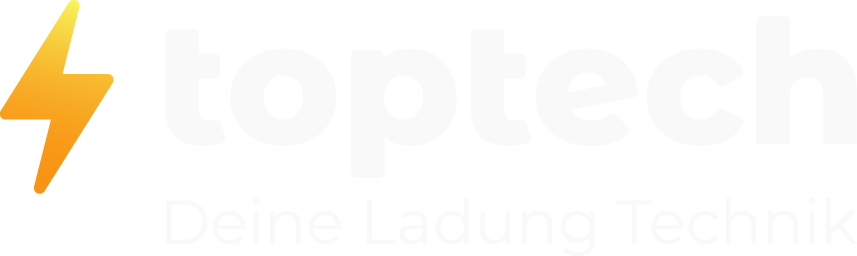Das Smart Home ist längst nicht mehr nur Eigenheimbesitzenden vorbehalten. Auch in Mietwohnungen finden sich zunehmend digitale Geräte, die den Alltag komfortabler gestalten – ganz ohne Bohren oder Verkabeln. Intelligente Leuchten, smarte Steckdosen oder Sprachassistenten lassen sich unkompliziert einrichten und bei einem Umzug ebenso leicht wieder entfernen.
Gleichzeitig stellen diese Technologien neue Anforderungen an die digitale Sicherheit. Viele Systeme sind permanent mit dem Internet verbunden – und damit potenziell angreifbar, insbesondere wenn grundlegende Schutzmaßnahmen fehlen.
Was zählt eigentlich als „smart“?
Smart-Home-Lösungen für Mieter:innen sind vielseitig einsetzbar und benötigen meist keine baulichen Veränderungen. Beispiele:
● Beleuchtung: Lampen, Lichtleisten oder Bewegungsmelder mit App-Steuerung
● Energie & Klima: Heizkörperthermostate, smarte Steckdosen, Luftsensoren
● Sicherheit: Mobile Kameras, Tür-/Fenstersensoren, Bewegungsmelder
● Multimedia & Komfort: Sprachassistenten, Lautsprecher, Jalousiesteuerung
● Automation: Routinen, Zeitschaltungen, Anwesenheitssimulationen
Die meisten dieser Geräte kommunizieren per WLAN, Bluetooth oder Funkstandards wie ZigBee. Sie lassen sich per Smartphone steuern und ohne Fachkenntnisse installieren – besonders praktisch in Mietverhältnissen mit eingeschränktem baulichen Spielraum.
Bequem, aber nicht ohne Risiko
Trotz ihrer Vorteile bergen Smart-Home-Geräte Sicherheitsrisiken. Laut der Verbraucherzentrale NRW hatten 2024 rund zwei Drittel der Nutzer:innen keine zusätzlichen Schutzvorkehrungen für ihre Geräte getroffen – ein Umstand, der Angriffe begünstigt.
Typische Schwachstellen:
● Werkseinstellungen werden nicht verändert (z. B. Standardpasswörter)
● Keine regelmäßigen Software-Updates
● Nutzung unsicherer WLAN-Konfigurationen
● Zentrale Steuerkonten ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung
● Unübersichtliche Geräteverknüpfungen über Cloud-Dienste
Solche Lücken können unbemerkt ausgenutzt werden – mit Folgen für die Privatsphäre der Nutzer:innen.
Mit wenigen Schritten zu mehr Sicherheit
Auch in Mietwohnungen lässt sich mit überschaubarem Aufwand ein solides Sicherheitsniveau erreichen. Wichtige Maßnahmen:
1. Geräteauswahl kritisch hinterfragen
Nicht jedes günstige Gerät erfüllt grundlegende Datenschutz- oder Sicherheitsstandards. Empfehlenswert sind Produkte mit:
● Regelmäßigen Updates
● Nachvollziehbaren Datenschutzrichtlinien
● Möglichkeit zur lokalen Steuerung (ohne Cloud-Zwang)
● Hersteller-Support und transparenten AGB
2. Heimnetzwerk strukturieren
Das eigene Netzwerk ist ein zentraler Sicherheitsfaktor. Maßnahmen:
● Gäste-WLAN für smarte Geräte einrichten
● Netzwerknamen (SSID) ändern, WPS-Funktion deaktivieren
● Router-Firmware aktuell halten, WPA3-Verschlüsselung nutzen
● Zugriffsrechte auf einzelne Geräte einschränken
3. Zugangsdaten sicher verwalten
Ein zentrales Einfallstor für Angriffe sind schwache oder mehrfach verwendete Passwörter – gerade bei der Einrichtung mehrerer Geräte in einem Haushalt. Viele Nutzer:innen neigen dazu, einfache oder identische Zugangsdaten für verschiedene Systeme zu verwenden, was das Risiko eines erfolgreichen Angriffs erhöht.
Für mehr Sicherheit empfiehlt sich:
● Jedes Gerät und jede App mit einem eigenen, starken Passwort zu sichern
● Auf Kombinationen aus Zahlen, Sonderzeichen und Groß-/Kleinschreibung zu achten
● Zugangsdaten regelmäßig zu aktualisieren
● Falls mehrere Personen im Haushalt Geräte nutzen: keine sensiblen Konten teilen, sondern getrennte Profile oder Zugänge anlegen
Um den Überblick zu behalten – insbesondere bei vielen unterschiedlichen Geräten und Plattformen – kann der Einsatz eines Passwort-Manager hilfreich sein. Solche Tools speichern alle Zugangsdaten verschlüsselt, ermöglichen die Erstellung starker Passwörter und reduzieren so das Risiko, dass schwache od
4. Rechte und Updates im Blick behalten
● Regelmäßig Updates der Gerätesoftware durchführen
● App-Berechtigungen kritisch prüfen
● Mehrbenutzerfunktionen sinnvoll nutzen, etwa für Mitbewohner:innen
● Vorhandene Verknüpfungen mit Drittanbietern gelegentlich kontrollieren
Sprachassistenten in WGs: Datenschutz braucht Abstimmung
Sprachgesteuerte Systeme wie Alexa oder Google Assistant sind in Wohngemeinschaften beliebt. Gleichzeitig werfen sie Fragen zum Datenschutz auf – insbesondere, wenn mehrere Personen dieselben Geräte verwenden.
Praktische Empfehlungen:
● Sprachaufnahmen regelmäßig löschen
● Sprachverlauf aktiv überwachen
● Nutzung individueller Stimmprofile
● Gemeinsame Regeln zur Steuerung und Gerätenutzung definieren
Transparenz und klare Absprachen können dabei helfen, mögliche Konflikte zu vermeiden.
Was ist erlaubt – und was nicht?
Grundsätzlich dürfen Mieter:innen smarte Geräte einsetzen, solange keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden. Dennoch gibt es rechtliche und datenschutzrechtliche Aspekte zu beachten:
● Kameras mit Außenblick: Aufnahmen dürfen nicht auf öffentliche Flächen oder Nachbargrundstücke gerichtet sein
● Video-Türklingeln: Besonders sensibel, da sie oft als Eingriff in die Privatsphäre gelten
● Kleben statt Bohren: In der Regel unproblematisch, aber beim Auszug rückstandsfrei zu entfernen
● Zentrale Haustechnik: Bei Heizungen oder Gegensprechanlagen ist die Nachrüstung meist eingeschränkt – Absprache mit Vermieter:in ist empfehlenswert
Beispiel aus der Praxis: Wenn Komfort zur Sicherheitslücke wird
In einer Berliner WG wurden diverse smarte Geräte installiert – vom Licht über Steckdosen bis zur Musikanlage. Alles lief über eine zentrale App. Was fehlte: ein sicheres WLAN, aktuelle Router-Firmware und eine klare Verwaltung der Zugriffsrechte.
Das Resultat: Ein Nachbar konnte sich unbemerkt ins Netzwerk einklinken und einen Lautsprecher fernsteuern – ein harmloser Vorfall mit ernster Bedeutung. Erst nach Anpassung des Routers, Einführung eines Passwort-Managers und Trennung der Netzwerke war wieder Kontrolle gegeben.
Smarte Mietwohnungen als Zukunftsmodell?
Immer mehr Vermieter:innen integrieren bereits beim Bau oder in der Sanierung Smart-Home-Technologien – etwa Heizungssteuerung oder Zutrittskontrollen. Für Mieter:innen bietet das zusätzlichen Komfort, erfordert aber gleichzeitig auch Wissen über sichere Nutzung.
Wichtig: Die Verantwortung für den sicheren Umgang mit Technik liegt nicht allein beim Vermieter. Auch Nutzer:innen müssen ihren Teil beitragen – durch regelmäßige Updates, sichere Passwörter und kritischen Umgang mit Berechtigungen.
Technik ja – aber sicher
Smart-Home-Technologien bieten Mieter:innen viele Möglichkeiten, Wohnkomfort und Energieeffizienz zu verbessern – ohne bauliche Veränderungen. Gleichzeitig erfordert die zunehmende Vernetzung ein grundlegendes Verständnis für digitale Sicherheit.
Mit einem bewussten Umgang bei Auswahl, Konfiguration und Nutzung der Geräte lässt sich auch in der Mietwohnung ein stabiles und datensicheres Smart Home realisieren – flexibel, rückbaufähig und zukunftsfähig.